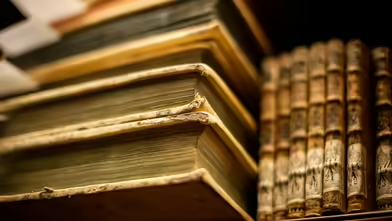Heinrich II. (973-1024), deutscher Kaiser und Bamberger Bistumsgründer, litt zeitlebens unter Beschwerden beim Gehen. Das hätten Untersuchungen seiner Gebeine bestätigt, erklärte der Bamberger Erzbischof Herwig Gössl. Nach Auskunft eines Bistumssprechers vom Dienstag bezeugten bisher nur Legenden und Darstellungen, dass Heinrich eine Art Klumpfuß hatte.

Eine Gelegenheit, dies auch wissenschaftlich zu untersuchen, bot sich mit der Rückgabe einer bedeutenden Heinrichs-Reliquie vergangenen Sommer aus Rom. Dort hatte sich seit etwa 1840 ein Oberschenkelknochen des Heiligen im Priesterseminar Collegium Germanicum et Hungaricum befunden. Die Einrichtung gilt als traditionelle Eliteschmiede des Klerus aus dem deutschen Sprachraum. Heinrichs zweiter Oberschenkelknochen wurde dagegen in der Sakristei des Bamberger Doms aufbewahrt.
Oberschenkelknochen feierlich beigesetzt
Beide Knochen wurden nun am Montagabend in einer feierlichen Zeremonie im Kaisergrab des Bamberger Doms bestattet. Gössl sagte, Heinrich sei trotz seiner Gesundheitsprobleme ständig im ganzen Reich unterwegs gewesen, auch um den Glauben zu verbreiten. "Die Reliquien wollen uns ermutigen, trotz aller Mühen und Schmerzen nicht aufzugeben."
Eine denkmalpflegerische und technische Herausforderung bestand in der Zusammenführung der sterblichen Überreste. Das Grabmal von Kaiser Heinrich und seiner ebenfalls heiligen Gattin Kunigunde zählt zu den Hauptsehenswürdigkeiten des Bamberger Doms, das schon im Mittelalter unzählige Pilger anzog. Geschaffen hat das Kunstwerk der geniale spätgotische Bildhauer Tilman Riemenschneider.
Grab "minimalinvasiv" geöffnet
Für die beiden Oberschenkel galt es das Grabmal möglichst schonend zu öffnen. Man entschied sich nach Bistumsangaben für einen "minimalinvasiven" Eingriff. Um die Knochen in einem zylindrischen, vergoldeten Gefäß ins Grab einzubringen, wurde an der Stirnseite eine Bronzetafel entfernt und ein Loch in das Grabmal gebohrt.

Die Authentizität der Oberschenkelknochen wurde nach Auskunft des Bistumssprechers außerdem durch einen anthropologischen Abgleich mit Heinrichs Haupt geprüft. Dieses ruht seit 1997 in einem Glasschrein unter einer Stele in einer Kapelle im Nordturm des Westchores. Die Untersuchung habe ergeben, dass Haupt und Knochen von derselben Person stammten.
Die steinernen, liegenden Figuren auf dem Grabmal suggerieren, das dort die Körper der Verstorbenen mehr oder minder vollständig eingebettet sind. Tatsächlich befinden sich darin aber nur je zwei Gebeinkisten mit wenigen sterblichen Überresten des Kaiserpaars.